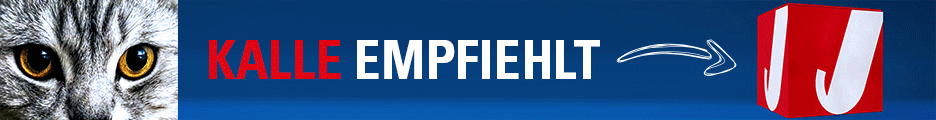HÖRBUCHT
LIEBERLING
Ausgerechnet eine Lücke ragt aus dem Werk des Joachim Meyerhoff heraus, eine entsetzliche Lücke. Brüllend komisch die Atmosphäre im Haus seiner genial eigenwilligen Großeltern in München, wie viel Fiktion auch immer hinter dem von Essen und dem zwingend dazu passenden Alkohol knallhart durchstrukturierten Tagesablauf der alten Herrschaften auch stecken mag. Der arglos mitwohnende Enkel steckt das harte Programm weit schlechter weg als die jahrelang daran gewöhnten Großeltern. Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, Meyerhoffs Erstling – „mein Lieberling“, wie die Großmutter sagen würde, eine einstige Schauspielerin. Große Vortragskunst, vom allerersten Kapitel an. Herrschaftszeiten! Grotesker Humor. In der Hörbucht…
Björn Simon
Joachim Meyerhoff
Man kann auch in die Höhe fallen
Argon Hörbuch
5 Sterne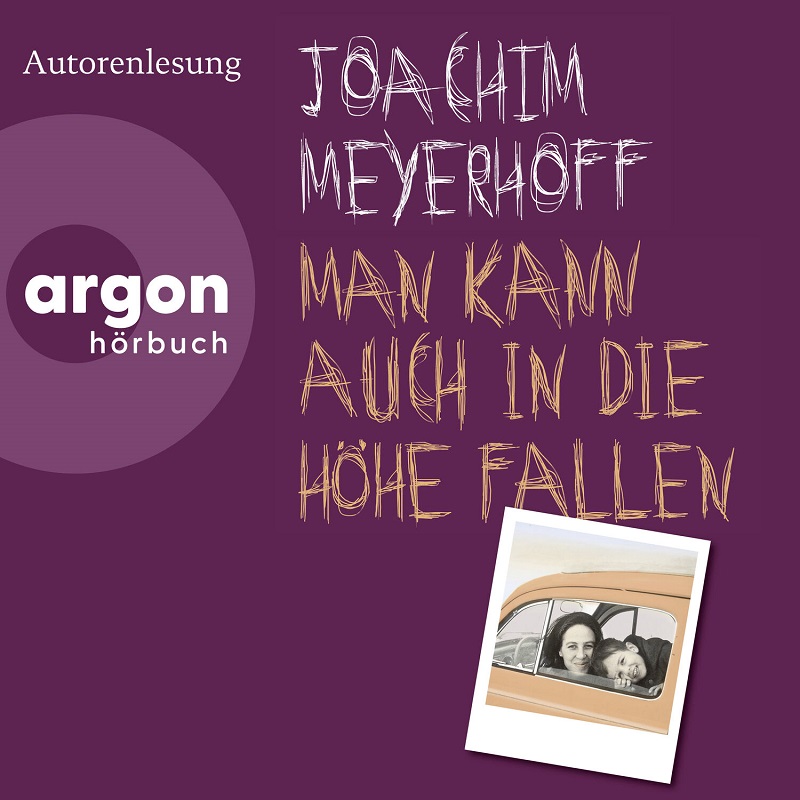
Was, bitte, ist ein „grotesker Humor“? Ein literarisch informierter Mensch der Prä-Wikipedia-Ära weiß sich zu helfen und schlägt nach bei den Brüdern Grimm, deren Deutsches Wörterbuch über das Adjektiv „grotesk“ zu berichten weiß, dass es „eigentlich … diejenige arbeit der bildhauer und mahler genennet, darinnen sie allerhand ungeschickte … bildungen von thieren, vögeln, halben menschen … u. dgl. künstlich durcheinander geflochten vorstellen …“ Während es zunächst noch im Wortsinne als „wunderlich geformt, verworren, verzerrt“ zu verstehen war, sei es bald „ins unsinnliche“ übertragen und „früh in Verbindungen“ wie vor allem „grotesk-komisch“ gebraucht worden. So wurde es „nachher zu einem allgemeinen kunstwort, das auch zu einer besonderen unterscheidung des komischen dienen muszte, das man nun da, wo es ins possirliche und phantastische fällt, das grotesk-komische nennt.“
So weit, so Grimm. Was aber hat das alles mit Joachim Meyerhoff zu tun?
Einiges. Der erfolgreiche Schauspieler und Autor der inzwischen auf sechs Bände angewachsenen, von Kritikern auch als „autobiografische Familienaufstellung“ bezeichneten Romanserie „Alle Toten fliegen hoch“ erhielt 2024 den Kassler Literaturpreis für grotesken Humor. Wer in die Liste der vergangenen Preisträger schaut, findet Meyerhoff dort in der Gesellschaft so verschiedener Autorinnen und Autoren wie Karen Duve, Dieter Hildebrandt, Robert Gernhardt, Loriot, Gerhard Polt, Helge Schneider und Heinz Struck, dass man darüber zu rätseln beginnt, welche Form der Groteske sie alle zu vereinen weiß. Vielleicht ist es ja wirklich vor allem das zunächst „wunderlich geformte“, dann ins „ins possirliche und phantastische“ sich wendende des Humors, das ihnen allen zu eigen ist. Für Joachim Meyerhoff jedenfalls gilt das ganz bestimmt. 1967 in Homburg/Saar geboren und in Schleswig aufgewachsen, hat er als Schauspieler an Theatern in Wien, Hamburg, Berlin und München gespielt, wurde dreimal zum Schauspieler des Jahres gewählt und begann 2011 die erwähnte Romanserie, deren bislang letzten Teil, „Man kann auch in die Höhe fallen“, er live vor Publikum in der Berliner Schaubühne vorgelesen hat. Die insgesamt zwölf Stunden und dreiundvierzig Minuten lange Aufzeichnung dieser Autorenlesung ist als Hörbuch im Argon Verlag erschienen, und wer Meyerhoffs Bücher kennt, der weiß, dass es sich dabei um eine ebenso berührende wie höchst vergnügliche Angelegenheit handelt.
Allenfalls könnte man sich fragen, warum es zu seinen bestens verkauften Romanen – „Man kann auch in die Höhe fallen“ erschien 2024 und ist ein Jahr später schon in der 5. Auflage erhältlich – noch ein Hörbuch geben muss. Doch die Antwort liegt auf der Hand: Besser als Meyerhoff zu lesen, ist nur, ihn zu hören (und, okay, ihn in der Steigerung live auf einer Bühne zu erleben). Er selbst sagt dazu in einem Interview, dass ihm als Schauspieler wie als Autor der Klang der Sprache besonders wichtig sei – er schreibe im Grunde so, wie er sich das gelesen vorstellen könne.
Womit wir uns also, beim Lesen wie beim Hören, im Kopf des Autors befinden.
Und worum geht es diesmal?
Um eine schwere Lebenskrise, in die der Ich-Erzähler gerät, nachdem er in Wien von einem Schlaganfall aus der Bahn geworfen wurde. Danach versucht er, in Berlin wieder neu Fuß zu fassen – „neues Theater, neue Kollegen, neue Stadt, neue Wege“ –, doch vergeblich. Schließlich zieht er zu seiner Mutter aufs Land, die dort unweit vom Meer ein sehr selbstbestimmtes Leben führt: „Ich redete mir ein, sie bedürfe dringend meines Beistands, dabei war sie kerngesund, offensiv vital, sah mit ihren sechsundachtzig Jahren fantastisch aus und kam bestens allein zurecht. Ich hingegen war derjenige, der nicht mehr klarkam und dem viele Fäden gerissen waren.“
Womit Meyerhoffs Humor gleich zu Beginn seiner Lesung eine erste (Er-)Klärung ermöglicht: Grotesk an seiner Form der Selberlebensbeschreibung ist der scheinbare Widerspruch von Nähe und Distanz. Einerseits ermöglicht sein Schreiben (und Vorlesen) dem Publikum, ihm so nahezukommen, wie man sich sonst höchstens selbst nahekommt oder -kommen mag. Andererseits ist da immer auch die Distanz der Fiktion, mit der sich der Autor das Publikum und vielleicht sich selbst vom Leibe hält. Oder um es in seinen Worten zu sagen: „Es steckt sehr, sehr viel Persönliches in meinen Büchern, und gleichzeitig brauche ich aber auch immer die Fiktion, um mich dem Persönlichen wirklich zu stellen.“
Dabei folgen wir ihm schon deshalb gern, weil seine Nöte auch die unseren sind: Wer noch nie Teile seines eigenen Lebensentwurfs als mal kläglich scheiternde, mal glorifizierend heitere Fiktion erkennen musste, wer also nicht auch über sich selbst lachen kann, der wird mit Meyerhoffs Literatur weniger anfangen können. Alle anderen aber wissen, wie grotesk-komisch das Leben sein kann.
Robert Fischer