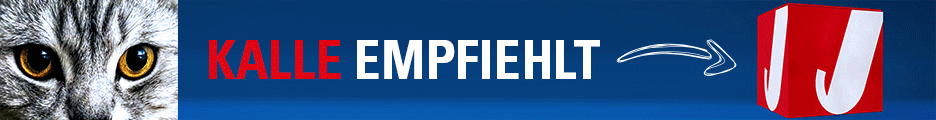Deutscher Jazzpreis 2025
E-Werk, Köln

© Robert Winter
Von Thomas Kölsch. Eine Preisverleihung an einem Freitag, dem 13., könnte ein schlechtes Omen sein – nicht aber beim Deutschen Jazzpreis 2025, der sich kurzerhand auf Thelonious Monks „Friday the 13th“ bezog und damit die Verleihung im Kölner E-Werk unter einen besonders hellen Stern stellte. Zu Recht, wie die Riege der Preisträgerinnen und Preisträger bewies. Bei der fünften Ausgabe wurden in 22 Kategorien 76 Nominierte geehrt, die die Grenzen des Spielbaren erweitert und neue Klangsprachen gesucht haben sowie mit ihrer Musik die Gegenwart und die Zukunft mitgestalten. Vor allem aber ging es immer wieder um Haltung, um die Relevanz von Jazz in Zeiten klammer Kassen und immer größer werdender gesellschaftlicher und politischer Krisen. Dieser Anspruch an den Jazz kann nicht hoch genug geschätzt werden – und wurde mehr als einmal bestätigt.

© Robert Winter
Vor allem die „diaspora-futuristische“ Band Sonic Interventions vereint all diese Aspekte wie kaum eine andere moderne Formation. Die Berliner Band zelebriert die Selbstbefreiung mit teils hypnotischen und teils explosiven Beiträgen, kommentiert die Einschränkung der Presse- und Meinungsfreiheit und setzt all dem ihre Musik entgegen. Kein Wunder, dass Sonic Interventions gleich in drei Kategorien nominiert waren. Letztlich gewannen sie in der Kategorie „Newcomer des Jahres“, nachdem sie zuvor mit einem Auftritt voller Kraft und starken Bildern das Publikum begeistert hatten. „Die Aufgabe eines Künstlers ist es, die Zeit zu reflektieren, in der er lebt“, zitierten sie Nina Simone und betonten, dass Jazz immer die Musik einer Befreiung war und ist. Ein kraftvolles Statement, das in dieser Deutlichkeit einzigartig war, im Verlauf des Abends aber in unterschiedlichen Ausprägungen immer wieder Thema war. Auch der Künstlerin des Jahres, Drummerin Eva Klesse, bescheinigte Jury-Sprecher Vincent Bababoutilabo eine eigene und sehr persönliche Handschrift, die nicht nur die Musik, sondern auch den Diskurs präge.
Doch auch die Reflektion nach innen ist im Jazz überaus präsent. So wurde mit Nduduzo Makhathini ein Künstler zum „Live Act des Jahres International“ gekürt, der die „Spiritualität des Sounds“ verkörpere und dessen Auftritte rituelle Erfahrungen seien, wie Laudatorin Karen Kennedy betonte. Und tatsächlich erwies sich der 42-jährige Pianist, der mit seiner Frau Omagugu (voc) auftrat, als Klang-Ästhet mit einem Faible für fast schon schamanische Erweckungserlebnisse.

© Robert Winter
Große Stimmen kamen auch anderweitig zu ihrem Recht: Mit Sera Kalo wurde eine Sängerin ausgezeichnet, deren einzigartiger Zugang zur Musik über alle Genregrenzen hinaus atemberaubend ist, und mit Uschi Brünning erhielt eine der großen Jazz-Sängerinnen der DDR – und darüber hinaus – mit dem Preis für ihr Lebenswerk eine angemessene Würdigung. Die 78-Jährige hat sich über fast sechs Dekaden hinweg immer wieder als gefühlvolle Interpretin deutschsprachiger Lieder erwiesen und zuletzt erst beim Jazzfest Bonn begeistert, wo sie kurzfristig für Norma Winstone einsprang und an der Seite von Kit Downes brillierte. Letzterer wurde übrigens in der Kategorie „Tasteninstrumente“ ausgezeichnet. „Künstler des Jahres International“ wurde der 101-jährige Saxofonist Marshall Allen, der das Sun Ra Arkestra maßgeblich mitprägte und mit diesem bis heute Aufnahmen macht. Das Album des Jahres kam von Peter Gall, im internationalen Kontext von ØKSE. „Wenn Free Jazz ein jüngeres und diverseres Publikum ansprechen und seine Relevanz zurückgewinnen will, braucht es Bands wie diese“, so Laudatorin Marieke Meischke.
Rund 1200 Bewerbungen hatte die Jury im Vorfeld erhalten, eine immens hohe Zahl, die zeigt, dass die Auszeichnung in seinem fünften Jahr überaus wertgeschätzt wird – angesichts eines Preisgelds von 4000 Euro allein für eine Nominierung und 12.000 Euro für eine Auszeichnung ist er nicht nur ideell, sondern auch finanziell in der Bundesrepublik einzigartig. 2026 wird der Jazzpreis in Bremen vergeben.